Bedeutende Aufsatzschreibkommode mit polychromen Chinoiserien Weichholz, weiß und grün gefasst, polychrome Bemalung und Vergoldung, feuervergoldete Bronze-/Messingbeschläge, späterer Seidensamt. A deux corps. Vierschübige, optisch fünfschübige Kommode unter schräger Pultlade. Innen acht Schübe in drei Reihen und acht Fächer. Mittig aufgebogener, eintüriger Schrankaufsatz. Innen zwölf Fächer und zehn Schübe um ein zentrales Fach mit Tür. Außen dreiseitig und oben auf dem aufgebogenen Giebel reich dekoriert mit weißgrundiger Lackmalerei, Chinoiserien in Etagenlandschaften mit Architektur, Pflanzen, Vögeln, auf den Seiten Paare mit Tigern, Kranichpaare, Balustraden, Bambus, Kirschblüten und Päonien, alle Details äußerst fein gemalt und in sehr gutem, originalem Erhaltungszustand mit wenigen punktuellen Retuschen. Die Dekorfelder gerahmt von Bordüren mit Textilornamenten. Reste einer Bleistiftsignatur hinten an der herausziehbaren linken Stützstrebe für die Pultlade. Vertikale Schwundrisse, in der vorderen unteren linken Ecke ein Insektenschaden, ein Bein gebrochen, ein Griffring verloren. H 223, B 94, T 52 cm. Dresden oder Warschau, Martin Schnell oder Werkstatt, zugeschrieben, um 1717 - 30.Ähnlich fein gemalte Chinoiserien finden wir nur im Oeuvre des Dresdner Lackkünstlers Martin Schnell (um 1675 - um 1740). Über ihn ist sehr wenig bekannt und das, was wir heute wissen, verdanken wir der Forschungsarbeit von Monika Kopplin und ihrer polnischen Kollegin Anna Kwiatkowska. Selbst der Ort seiner Geburt, die niedersächsische Stadt Stade, weiter unten an der Elbe gelegen, ist nicht gesichert. Der erste auf ihn bezogene Akteneintrag stammt vom 22. Januar 1710, in dem Martin Schnell zum "Hoflacquirer" in Dresden ernannt wird. Wo er sein Handwerk erlernte, ist unbekannt. Aber zu diesem Zeitpunkt, 1710, muss er es bereits vollendet beherrscht haben. Der sächsische Kurfürst und polnische König August II. besaß in seinen umfangreichen und einzigartigen Sammlungen chinesische Objekte, an denen Martin Schnells Fähigkeiten gemessen wurden. Seine bei Hof vorgeführten Erzeugnisse waren also offensichtlich überzeugend. Ab 1717 wurde Martin Schnell zur Dekoration im Japanischen Palais herangezogen, teils zur wandgebundenen, teils zur mobilen Ausstattung. Zu dieser zählten alle Arten von höfischen Möbeln und natürlich Aufsatzschränke. Seine Gold- und Lackmalereien überzogen sogar japanische blauweiße Deckeltöpfe - wurden allerdings auf Anordnung des Königs kurz danach wieder "rein gewaschet u. das laquirte davon abgekrazet" (Ströber, "La maladie de porcelaine..." Ostasiatisches Porzellan aus der Sammlung Augusts des Starken, Berlin 2001, Nr. 67). Erfolgreicher waren seine Dekore für die Meissener Manufaktur, auf polierten roten Böttgersteinzeugen, Vasen, Kannen, Koppchen. Spätestens um 1730 hielt sich Martin Schnell dauerhaft in Warschau auf, wohin er zur Umgestaltung des Schlosses Wilanów abgeordert wurde. Sein wohl bis 1732 fertiggestelltes, atemberaubendes Lackkabinett zählt zu den Höhepunkten europäischer Lackkunst. Die Vielfalt der dargestellten exotischen Szenen, die reiche Farbigkeit und der glimmernde Aventurinfond wirken noch heute magisch auf alle Besucher. Im Zuge der Katalogerstellung und Ausstellung 2005 kam ein Möbel in den Fokus der Forschung, das sich heute im Berliner Kunstgewerbemuseum befindet, der Kabinettschrank, der Martin Schnell und seiner Werkstatt 1717 - 1721 zugeschrieben wird. Dieses Möbel belegt, dass Martin Schnell tatsächlich ziemlich exakt chinesische Tuschezeichnungen kopierte, die ihm wohl aus den königlichen Beständen zur Verfügung gestellt wurden. Das bestätigt sich auch auf dem hier vorgestellten Aufsatzmöbel - die Szenen sprengen das Repertoire an "europäischen" Chinoiserien, das wir z.B. von Grafiken von Petrus Schenk und Johann Christoph Weigel kennen. Der Künstler dieses Schranks verstand und beherrschte die chinesische Malerei wie kaum ein zweiter Europäer. Alle Details sind identifizierbar und exakt wiede
Bedeutende Aufsatzschreibkommode mit polychromen Chinoiserien Weichholz, weiß und grün gefasst, polychrome Bemalung und Vergoldung, feuervergoldete Bronze-/Messingbeschläge, späterer Seidensamt. A deux corps. Vierschübige, optisch fünfschübige Kommode unter schräger Pultlade. Innen acht Schübe in drei Reihen und acht Fächer. Mittig aufgebogener, eintüriger Schrankaufsatz. Innen zwölf Fächer und zehn Schübe um ein zentrales Fach mit Tür. Außen dreiseitig und oben auf dem aufgebogenen Giebel reich dekoriert mit weißgrundiger Lackmalerei, Chinoiserien in Etagenlandschaften mit Architektur, Pflanzen, Vögeln, auf den Seiten Paare mit Tigern, Kranichpaare, Balustraden, Bambus, Kirschblüten und Päonien, alle Details äußerst fein gemalt und in sehr gutem, originalem Erhaltungszustand mit wenigen punktuellen Retuschen. Die Dekorfelder gerahmt von Bordüren mit Textilornamenten. Reste einer Bleistiftsignatur hinten an der herausziehbaren linken Stützstrebe für die Pultlade. Vertikale Schwundrisse, in der vorderen unteren linken Ecke ein Insektenschaden, ein Bein gebrochen, ein Griffring verloren. H 223, B 94, T 52 cm. Dresden oder Warschau, Martin Schnell oder Werkstatt, zugeschrieben, um 1717 - 30.Ähnlich fein gemalte Chinoiserien finden wir nur im Oeuvre des Dresdner Lackkünstlers Martin Schnell (um 1675 - um 1740). Über ihn ist sehr wenig bekannt und das, was wir heute wissen, verdanken wir der Forschungsarbeit von Monika Kopplin und ihrer polnischen Kollegin Anna Kwiatkowska. Selbst der Ort seiner Geburt, die niedersächsische Stadt Stade, weiter unten an der Elbe gelegen, ist nicht gesichert. Der erste auf ihn bezogene Akteneintrag stammt vom 22. Januar 1710, in dem Martin Schnell zum "Hoflacquirer" in Dresden ernannt wird. Wo er sein Handwerk erlernte, ist unbekannt. Aber zu diesem Zeitpunkt, 1710, muss er es bereits vollendet beherrscht haben. Der sächsische Kurfürst und polnische König August II. besaß in seinen umfangreichen und einzigartigen Sammlungen chinesische Objekte, an denen Martin Schnells Fähigkeiten gemessen wurden. Seine bei Hof vorgeführten Erzeugnisse waren also offensichtlich überzeugend. Ab 1717 wurde Martin Schnell zur Dekoration im Japanischen Palais herangezogen, teils zur wandgebundenen, teils zur mobilen Ausstattung. Zu dieser zählten alle Arten von höfischen Möbeln und natürlich Aufsatzschränke. Seine Gold- und Lackmalereien überzogen sogar japanische blauweiße Deckeltöpfe - wurden allerdings auf Anordnung des Königs kurz danach wieder "rein gewaschet u. das laquirte davon abgekrazet" (Ströber, "La maladie de porcelaine..." Ostasiatisches Porzellan aus der Sammlung Augusts des Starken, Berlin 2001, Nr. 67). Erfolgreicher waren seine Dekore für die Meissener Manufaktur, auf polierten roten Böttgersteinzeugen, Vasen, Kannen, Koppchen. Spätestens um 1730 hielt sich Martin Schnell dauerhaft in Warschau auf, wohin er zur Umgestaltung des Schlosses Wilanów abgeordert wurde. Sein wohl bis 1732 fertiggestelltes, atemberaubendes Lackkabinett zählt zu den Höhepunkten europäischer Lackkunst. Die Vielfalt der dargestellten exotischen Szenen, die reiche Farbigkeit und der glimmernde Aventurinfond wirken noch heute magisch auf alle Besucher. Im Zuge der Katalogerstellung und Ausstellung 2005 kam ein Möbel in den Fokus der Forschung, das sich heute im Berliner Kunstgewerbemuseum befindet, der Kabinettschrank, der Martin Schnell und seiner Werkstatt 1717 - 1721 zugeschrieben wird. Dieses Möbel belegt, dass Martin Schnell tatsächlich ziemlich exakt chinesische Tuschezeichnungen kopierte, die ihm wohl aus den königlichen Beständen zur Verfügung gestellt wurden. Das bestätigt sich auch auf dem hier vorgestellten Aufsatzmöbel - die Szenen sprengen das Repertoire an "europäischen" Chinoiserien, das wir z.B. von Grafiken von Petrus Schenk und Johann Christoph Weigel kennen. Der Künstler dieses Schranks verstand und beherrschte die chinesische Malerei wie kaum ein zweiter Europäer. Alle Details sind identifizierbar und exakt wiede


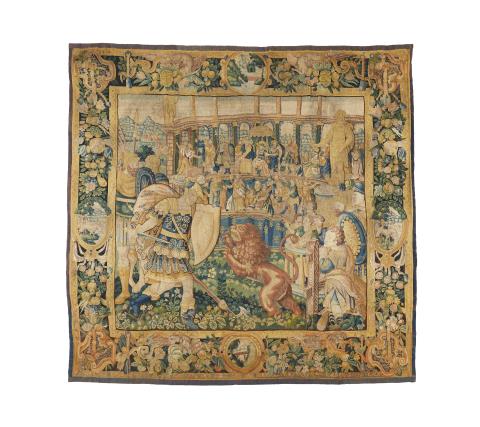












Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!
Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.
Suchauftrag anlegen