Merkur, Öl auf Holz, 168 x 109,5 cm, gerahmt Provenienz: Sammlung F. G. di Torelli, Villa Torelli di Gualtieri, Reggio Emilia, um 1930; Sammlung Publio Podio, Bologna, vor 1937; Auktion, Sotheby’s, London, 5. Juli 1967, Los 107 (als Matteo oder Bartolomeo di Giovanni); Europäische Privatsammlung Literatur: M. Tamassia, Collezioni d’arte tra Ottocento e Novecento, Jacquier fotografi a Firenze, 1870–1935, Neapel 1995, S. 118/119, Abb. 51111 (als Paduanisch-Ferrareser Schule, 15. Jahrhundert) Das vorliegende Gemälde ist in der Fototeca Zeri (Nr. 24237) als Werk des Meisters der Geschichte der Helena verzeichnet. Die elegante Gestalt der vorliegenden Komposition trägt die traditionellen Attribute des Gottes Merkur: Caduceus, Helm und Flügelschuhe. Auf dem Boden liegt das abgeschlagene Haupt Argos’, des hundertäugigen Wächters, dem Juno die Nymphe Io anvertraut hatte, die zuvor von Jupiter – in einem Versuch, sie vor dem Zorn seiner eifersüchtigen Frau zu schützen – in eine junge Kuh verwandelt worden war. Auch die anderen Attribute des Gottes – das Krummschwert und das Musikinstrument – sind dem klassischen Mythos entnommen, wie er in den moralisierenden mittelalterlichen Fassungen von Ovids Metamorphosen nacherzählt wird. Demzufolge wurde Merkur von seinem Vater Jupiter entsandt, um Io zu befreien: Er enthauptete Argos mit einem Krummschwert, nachdem er ihn durch seine Musik in den Schlaf versenkt hatte (den Quellen zufolge handelte es sich um ein Blasinstrument). Als das vorliegende Gemälde entstand, galt das abgetrennte Haupt Argos’ dank der weit verbreiteten sogenannten Tarocchi di Mantegna, einer vermutlich in Ferrara um 1465 entstandenen Stichserie, die über das folgende Jahrzehnt auch in Emilia und im Veneto kursierte, als eines der traditionellen Attribute Merkurs (siehe Susanne Pollack, Cosmè Tura e Francesco del Cossa L’arte a Ferrara nell’età di Borso d’Este, Ausstellungskatalog, Palazzo dei Diamanti, hrsg. von Mauro Natale, Ferrara 2007, S. 398–403). Die im vorliegenden Torelli-Gemälde dargestellte Gottheit ist jedoch nicht direkt dem maßgeblichen Kupferstich der Tarocchi entnommen (A/XXXXII), sondern weicht in einigen Details von ihm ab. Die kulturelle Bandbreite des vorliegenden Gemäldes zeigt sich auch im fragmentarischen Vorhandensein eines weiteren zeitgenössischen Werks auf der Rückseite mit einem Herkules im Kampf mit der Hydra. Die einzigen erhaltenen identifizierbaren Teile sind der Kopf des Helden im Profil und das offene Maul und die eingedrehten Tentakeln des Ungeheuers. Durch die stark lückenhafte Darstellung auf der Rückseite sind Kohlestudien zu Fuß oder zu Pferde kämpfender Aktfiguren erkennbar, die direkt auf den Holzgrund übertragen wurden. Sie zeichnen sich durch eine klare Bewegungsanatomie mit komplexen perspektivischen Verkürzungen aus. Auf der Rückseite der Tafel verbliebene Einkerbungen zweier Scharniere und vermutlich eines Riegels weisen unverkennbar darauf hin, dass das Bild ursprünglich als bewegliches Element eines größeren dekorativen Ensembles mit Darstellungen antiker Gottheiten und Helden intendiert und angesichts der Ausmaße der vorliegenden Bildtafel sehr bedeutsam gewesen sein muss. Bei den durchgepausten kämpfenden Aktfiguren im oberen Teil der Tafel könnten es sich um Studien für ein Schmuckband gehandelt haben, das in Nachahmung eines klassischen Frieses Bestandteil der vorliegenden Tafel gewesen sein mag. Die vorliegende Tafel wurde erstmals bekannt, als sie um 1930–1935 in die Werkstatt des Restaurators und Sammlers Publio Podio in Bologna gelangte, wo sie vom Florentiner Fotoatelier Jacquier aufgenommen wurde. Im Juli 1967 wurde sie bei Sotheby’s in London mit einer irreführenden Zuschreibung an Matteo di Giovanni auktioniert. Diese Zuschreibung wurde später von Miklós Boskovits zugunsten des venezianischen Maestro delle Storie di Elena korrigiert (siehe M. Tamassia, Collezioni d’arte tra Ottocento e Novecento. Jacquier fotografi a Firenze, 1870–1935, Neapel 1995, S. 118, Abb.
Merkur, Öl auf Holz, 168 x 109,5 cm, gerahmt Provenienz: Sammlung F. G. di Torelli, Villa Torelli di Gualtieri, Reggio Emilia, um 1930; Sammlung Publio Podio, Bologna, vor 1937; Auktion, Sotheby’s, London, 5. Juli 1967, Los 107 (als Matteo oder Bartolomeo di Giovanni); Europäische Privatsammlung Literatur: M. Tamassia, Collezioni d’arte tra Ottocento e Novecento, Jacquier fotografi a Firenze, 1870–1935, Neapel 1995, S. 118/119, Abb. 51111 (als Paduanisch-Ferrareser Schule, 15. Jahrhundert) Das vorliegende Gemälde ist in der Fototeca Zeri (Nr. 24237) als Werk des Meisters der Geschichte der Helena verzeichnet. Die elegante Gestalt der vorliegenden Komposition trägt die traditionellen Attribute des Gottes Merkur: Caduceus, Helm und Flügelschuhe. Auf dem Boden liegt das abgeschlagene Haupt Argos’, des hundertäugigen Wächters, dem Juno die Nymphe Io anvertraut hatte, die zuvor von Jupiter – in einem Versuch, sie vor dem Zorn seiner eifersüchtigen Frau zu schützen – in eine junge Kuh verwandelt worden war. Auch die anderen Attribute des Gottes – das Krummschwert und das Musikinstrument – sind dem klassischen Mythos entnommen, wie er in den moralisierenden mittelalterlichen Fassungen von Ovids Metamorphosen nacherzählt wird. Demzufolge wurde Merkur von seinem Vater Jupiter entsandt, um Io zu befreien: Er enthauptete Argos mit einem Krummschwert, nachdem er ihn durch seine Musik in den Schlaf versenkt hatte (den Quellen zufolge handelte es sich um ein Blasinstrument). Als das vorliegende Gemälde entstand, galt das abgetrennte Haupt Argos’ dank der weit verbreiteten sogenannten Tarocchi di Mantegna, einer vermutlich in Ferrara um 1465 entstandenen Stichserie, die über das folgende Jahrzehnt auch in Emilia und im Veneto kursierte, als eines der traditionellen Attribute Merkurs (siehe Susanne Pollack, Cosmè Tura e Francesco del Cossa L’arte a Ferrara nell’età di Borso d’Este, Ausstellungskatalog, Palazzo dei Diamanti, hrsg. von Mauro Natale, Ferrara 2007, S. 398–403). Die im vorliegenden Torelli-Gemälde dargestellte Gottheit ist jedoch nicht direkt dem maßgeblichen Kupferstich der Tarocchi entnommen (A/XXXXII), sondern weicht in einigen Details von ihm ab. Die kulturelle Bandbreite des vorliegenden Gemäldes zeigt sich auch im fragmentarischen Vorhandensein eines weiteren zeitgenössischen Werks auf der Rückseite mit einem Herkules im Kampf mit der Hydra. Die einzigen erhaltenen identifizierbaren Teile sind der Kopf des Helden im Profil und das offene Maul und die eingedrehten Tentakeln des Ungeheuers. Durch die stark lückenhafte Darstellung auf der Rückseite sind Kohlestudien zu Fuß oder zu Pferde kämpfender Aktfiguren erkennbar, die direkt auf den Holzgrund übertragen wurden. Sie zeichnen sich durch eine klare Bewegungsanatomie mit komplexen perspektivischen Verkürzungen aus. Auf der Rückseite der Tafel verbliebene Einkerbungen zweier Scharniere und vermutlich eines Riegels weisen unverkennbar darauf hin, dass das Bild ursprünglich als bewegliches Element eines größeren dekorativen Ensembles mit Darstellungen antiker Gottheiten und Helden intendiert und angesichts der Ausmaße der vorliegenden Bildtafel sehr bedeutsam gewesen sein muss. Bei den durchgepausten kämpfenden Aktfiguren im oberen Teil der Tafel könnten es sich um Studien für ein Schmuckband gehandelt haben, das in Nachahmung eines klassischen Frieses Bestandteil der vorliegenden Tafel gewesen sein mag. Die vorliegende Tafel wurde erstmals bekannt, als sie um 1930–1935 in die Werkstatt des Restaurators und Sammlers Publio Podio in Bologna gelangte, wo sie vom Florentiner Fotoatelier Jacquier aufgenommen wurde. Im Juli 1967 wurde sie bei Sotheby’s in London mit einer irreführenden Zuschreibung an Matteo di Giovanni auktioniert. Diese Zuschreibung wurde später von Miklós Boskovits zugunsten des venezianischen Maestro delle Storie di Elena korrigiert (siehe M. Tamassia, Collezioni d’arte tra Ottocento e Novecento. Jacquier fotografi a Firenze, 1870–1935, Neapel 1995, S. 118, Abb.







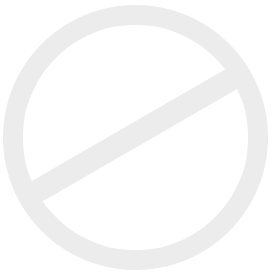





Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!
Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.
Suchauftrag anlegen